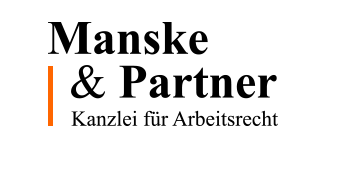Bundesverfassungsgericht sieht Tarifeinheitsgesetz weitgehend als mit dem Grundgesetz vereinbar
Das von vielen Spartengewerkschaften vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffene und umstrittene Tarifeinheitsgesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles hat nach dem Urteil vom 11.07.2017 im Grundsatz Bestand. Zwei der acht Richter teilten das Urteil nicht und legten Sondervoten ein. Eingeordnet unter Sonstiges.
Bereits im Jahr 2010 hielt das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil fest, dass in einem Betrieb mehrere verschiedene Tarifverträge nebeneinander möglich sind und erteilte dem Prinzip „ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ eine teilweise Absage.
Diese Tarifeinheit sollte sodann durch Gesetz geschaffen werden. Nur so könne man Kollisionen vermeiden und die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie gewährleisten.
Mit dem Tarifeinheitsgesetz, dieser seit rund zwei Jahren geltenden Neuregelung, sollen Dauerarbeitskämpfe konkurrierender Gewerkschaften im selben Betrieb verhindert werden. Bei fehlender Einigung der Gewerkschaften über ein gemeinsames Vorgehen soll letztlich nur der Tarifvertrag mit der stärksten Gewerkschaft im Betrieb gelten.
Es soll nach dem Prinzip „ein Betrieb - ein Tarifvertrag“ bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb Tarifeinheit per Gesetz geschaffen werden. Zu solchen Tarifkollisionen kommt es, wenn zwei konkurrierende Gewerkschaften im Betrieb sich nicht über ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Nach der Neuregelung soll die Gewerkschaft den Tarifvertrag abschließen, die über die meisten Mitglieder im Betrieb verfügt. Wer die meisten Mitglieder im Betrieb hat, soll im Zweifel das Arbeitsgericht klären.
Viele, insbesondere kleinere Gewerkschaften, wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Beamtenbund dbb sehen in diesen Regelungen die faktische Aushöhlung ihres Streikrechts und einen Verdrängungswettbewerb in den Betrieben. Sie legten Verfassungsbeschwerde ein.
Das Bundesverfassungsgericht bestätigt in seinem Urteil vom 11.07.2017 das Gesetz, gibt aber auch Vorgaben zur Auslegung und Handhabung des Gesetzes, um der in Art. 9 Abs. 3 GG rechtlich geschützten Tarifautonomie Rechnung zu tragen. Außerdem gibt es dem Gesetzgeber zum Schutz kleiner Gewerkschaften auf, bis zum Ende des Jahres 2018 nachzubessern. So dürfen die Belange der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge nicht „einseitig vernachlässigt“ werden und müssen dem Gesetz zum Schutz kleiner Spartengewerkschaften noch „Schärfen genommen werden“ Bis zur Neuregelung darf ein Tarifvertrag daher im Fall der Kollision im Betrieb nur dann verdrängt werden, wenn ausreichend dargelegt ist, dass die Belange der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaften ernsthaft und wirksam durch die Mehrheitsgewerkschaft in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt wurde. Im Übrigen bleibt das Gesetz nach vorstehender Maßgabe anwendbar.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzgeber hierdurch die Konkurrenzen in einzelnen Betrieben verschärft, bleibt bestehen. Die Neuregelung schränkt jedenfalls indirekt das Streikrecht ein. Denn streiken darf nur, wer ein erreichbares Ziel wie einen Tarifvertrag anstrebt, sonst gilt der Streik als unverhältnismäßig und rechtswidrig. Eine Minderheitsgewerkschaft, die keinen Tarifvertrag abschließen kann, darf also nicht zu dem Mittel des Streiks greifen.
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht